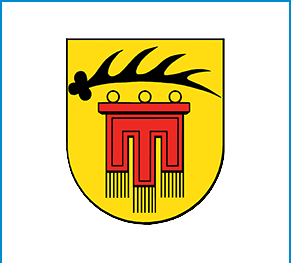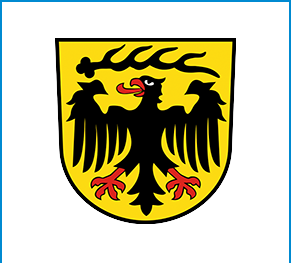Die Bedeutung kommunaler Wählergemeinschaften und ihre Diskriminierung im politischen Wettbewerb
Festvortrag beim 10-jährigen Jubiläum der Freien Wähler
im Rems-Murr-Kreis am 29.11.2006 in Winnenden
Die Freien Wähler haben eine zentrale Bedeutung für die kommunale Demokratie. Denn die Freien Wähler werden dem Sinn der kommunalen Selbstverwaltung in besonderem Maße gerecht. Das wird vielfach verkannt, teilweise auch von den Freien Wählern selbst und von den politischen Parteien wird diese, für sie höchst unbequeme, Erkenntnis ohnehin gern unterdrückt. Ich muß diese erste zentrale These meines Vortrags deshalb näher begründen.
Die kommunale Selbstverwaltung lebt seit ihrer Wiederbegründung vor 200 Jahren durch den Freiherrn vom Stein vom Engagement der Bürgerschaft, und zwar vom Engagement der Bürgerschaft in der jeweiligen Kommune: in der Gemeinde, in der Stadt und im Landkreis. Die kommunale Demokratie ist nur dadurch als eigenständige Institution zu rechtfertigen, daß sie ihre Entscheidungen an den speziellen Gegebenheiten der einzelnen Kommune ausrichtet. Käme es nicht auf die Besonderheiten der jeweiligen Kommune an, könnten deren Geschicke ja auch zentral, also vom Land oder gar vom Bund entschieden werden und wir bräuchten die kommunale Selbstverwaltung gar nicht.
Diesem Sinn, dieser Idee der kommunalen Selbstverwaltung entsprechen kommunale Wählergemeinschaft besonders gut. Denn sie konzentrieren sich allein auf die politische Aktivität in einer, in ihrer jeweiligen Kommune.
Demgegenüber tendieren politische Parteien zur Einebnung der Unterschiede. Sie sind gesamtstaatliche Organisationen mit gesamtstaatlichen Programmen, auch mit gesamtstaatlichen kommunalen Programmen. Politische Parteien neigen aufgrund ihrer übergreifenden Ziele und Ideologien – eher zu zentralisierten einheitlichen Entscheidungen und versuchen, diese nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch im kommunalen Bereich umzusetzen. Das führt etwa dazu, daß Parteien im Kommunalwahlkampf auch mit landespolitischen und bundespolitischen Themen werben und Punkte zu machen versuchen, obwohl diese Themen gar nicht in die Kompetenz der Kommunen fallen. Die Parteien spekulieren dabei teils auf die Unkenntnis der Wähler über die wahre Verteilung der Zuständigkeiten in unserem Staat, teils missbrauchen Parteien die Kommunalwahlen auch ganz gezielt als Akklamationsbühne und Resonanzboden für ihre Landes- oder Bundespolitik. Einflussreichen Führern von politischen Parteien kommt es regelmäßig auf Regierungspositionen im Staat an. Die Parteispitze betrachtet Kommunalwahlen deshalb oft nur als Etappenziel zur Sicherung dieses eigentlichen Endziels: der Erringung der Macht im Staate, und als bloßes Stimmungsbarometer. Dabei kommen kommunale Belange leicht zu kurz.
Das alles steht in Widerspruch zum Gedanken der kommunalen Selbstverwaltung und hat mit kommunaler Demokratie nur noch wenig zu tun.
Alles in allem sind Parteien wie ein unvoreingenommener Kenner der Kommunalpolitik formuliert hat „latente Gegner differenzierender Entscheidungen“. In der unterschiedlichen, auf die jeweiligen Sonderprobleme der einzelnen Kommune bezogenen Politik liegt aber gerade die eigentliche Begründung der kommunalen Selbstverwaltung.
Es war deshalb nur konsequent, daß große Teile der Staatsrechtslehre noch in den fünfziger und sechziger Jahren davon ausgingen, Parteien hätten aufgrund ihrer primär gesamtstaatlichen Ziele, Bestrebungen und Ausrichtung – auf kommunaler Ebene nichts zu suchen. Die Realität ist darüber bekanntlich inzwischen hinweggegangen.
Bei kommunalen Wählergemeinschaften ist alles anders. Freie Wähler haben allein die Belange ihrer jeweiligen Gemeinde oder ihres Landkreises im Auge. Sie haben keine Interessen auf Bundes- und Landesebene es sei denn, solche, die die Interessen ihrer Kommune betreffen. Kommunale Wählergemeinschaften entsprechen deshalb der Idee der kommunalen Selbstverwaltung in vollem Umfang, und sehr viel besser als die Parteien.
Angesichts ihrer besonderen Nähe zur kommunalen Selbstverwaltung hätten die Freien Wähler es eigentlich verdient, besonders gefördert zu werden und einen privilegierten Status zu bekommen. Um so paradoxer muß es anmuten, dass die kommunalen Wählergemeinschaften gegenüber den Parteien, mit denen sie auf kommunaler Ebene in Wettbewerb stehen, diskriminiert werden. Auch diese zweite These muß ich angesichts des darin enthaltenen Vorwurfs näher begründen. Des werde ich am Beispiel von vier Politikbereichen tun:
dem Wahlrecht,
der Kommunalverfassung,
der staatlichen Parteienfinanzierung und
der parteipolitischen Ämterpatronage.
Der eigentliche Grund für die Diskriminierung der Freien Wähler ist ebenso trivial wie für die Freien Wähler fatal:
In den Parlamenten des Bundes und der Länder sitzen nur die politischen Parteien, nicht auch die Wählergemeinschaften. Die Gesetze und Haushaltspläne werden also allein von den Abgeordneten der Parteien beschlossen. Die Freien Wähler sind völlig aus dem Spiel. Das gilt auch für solche Regelungen, die den Wettbewerb zwischen Parteien und Wählergemeinschaften auf kommunaler Ebene betreffen. Denn auch die werden vom Bund und von den Ländern gemacht und nicht von den Kommunen. Die Spielregeln des Erwerbs von Macht, Posten und Geld werden also von den politischen Parteien in den staatlichen Parlamenten aufgestellt, nicht auch von den Wählergemeinschaften. Dass es bei dieser Ausgangssituation zu schlimmen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der Freien Wähler kommen kann, liegt auf der Hand. Die politischen Parteien erliegen immer wieder der Versuchung, ihre einseitige Machtposition in den Parlamenten zum eigenen Vorteil zu missbrauchen und die Freien Wähler zu diskriminieren. Will man sich klarmachen, was das in Wahrheit bedeutet, so muss man sich zwei Mannschaften vorstellen, die sich zu einem sportlichen Wettbewerb treffen. Vorher werden die Regeln festgelegt, nach denen das Spiel ablaufen soll. Doch diese Festlegung trifft nur eine Mannschaft allein, und diese ist sogar in der Lage, die Regeln noch während des Spieles zu ihren Gunsten zu ändern.
Dass eine solche Situation den Grundsätzen der Fairneß widerspricht, wird jedem einleuchten. Nur wenige machen sich aber klar, daß genauso die Lage im Verhältnis der Freien Wähler zu den Parteien ist: Die Freien Wähler müssen mit Wettbewerbsregeln zurechtkommen, die ihre politischen Gegner gemacht haben.
Da die Diskriminierung der einen immer auch eine Kehrseite hat, nämlich die Privilegierung der anderen, müssen auch einige Privilegien angesprochen werden, die sich die politische Parteien und ihre Amtsträger in eigener Sache und im eigenen Interesse verschafft haben. Überhaupt lässt sich am vorliegenden Thema zeigen, welche Kräfte und Motive in der politischen Wirklichkeit dominieren.
Zunächst zum Wahlrecht: In den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch Deutschlands, nach dem Zweiten Weltkrieg, spielten die Freien Wähler eine gewaltige, ja geradezu dominierende politische Rolle auf kommunaler Ebene. Sie wurden dann durch die politischen Parteien aber immer stärker zurückgedrängt. Dies geschah ganz wesentlich auch dadurch, daß die Parteien ihre Gesetzgebungsmacht in den Landesparlamenten gezielt missbrauchten und Gesetze erließen, die es nur politischen Parteien erlaubten, bei Kommunalwahlen zu kandidieren. Ein Beispiel war das nordrhein-westfälische Kommunalwahlgesetz von 1952, welches das Recht, Wahllisten aufzustellen, ausdrücklich auf politische Parteien beschränkte. Dadurch wurden parteifreie Kandidaten und kommunale Wählergemeinschaften von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Eigentlich ein unfassbarer Vorgang, aber so war es. Ähnliches stand in dem niedersächsischen Kommunalwahlgesetz von 1956 und dem saarländischen Gemeinde- und Kreiswahlgesetz von 1960. So hieß es beispielsweise in dem zuletzt genannten Gesetz: „Wahlvorschläge können nur von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes aufgestellt werden.“ Und dazu gehören Freier Wähler bekanntlich nicht.
Derartige Regeln, die den kommunalen Wählergemeinschaften für immer den Garaus gemacht hätten, bestünden noch heute, hätte das Bundesverfassungsgericht sie nicht 1960 wegen Verstoßes gegen die Grundsätze der Offenheit und Chancengleichheit des politischen Wettbewerbs und der kommunalen Selbstverwaltung beseitigt. Doch die faktischen Folgen des früheren Verbots konnten nachträglich nicht mehr ganz rückgängig gemacht werden. In Nordrhein-Westfalen waren die kommunalen Wählergemeinschaften acht Jahre (1952 bis 1960), in Niedersachsen vier Jahre lang (1956 bis 1960) aus den Kommunalvertretungen ausgeschlossen – und haben sich von der dadurch bedingten politischen Schwächung nie wieder völlig erholt.
Dafür trägt allerdings auch das Bundesverfassungsgericht selbst Mitverantwortung. Das Gericht hatte in einer früheren Entscheidung unter dem unseligen Einfluß der völlig überzogenen Parteienstaatsdoktrin des Verfassungsrichters Gerhard Leibholz nämlich selbst den Eindruck erweckt, es würde ein gesetzliches Parteienmonopol akzeptieren. Dadurch wurden die Landesgesetzgeber zu derartigen Vorschriften, die die Freien Wähler von der Teilnahme an Kommunalwahlen ausschließen, geradezu ermutigt. Die Parteien bestellen eben auch die Verfassungsrichter. Darauf werde ich noch zurückkommen.
Ein zweiter Problembereich betrifft die Kommunalverfassung. Wir hatten in der Bundesrepublik in der Vergangenheit lange zwei typische Arten von Kommunalverfassungen. Die eine kann man als „Parteiverfassung“ bezeichnen, die andere als „Bürgerverfassung“.
Der Typ der „Parteiverfassung“, wie er z.B. in Nordrhein-Westfalen bestand, war dadurch gekennzeichnet, dass die politischen Parteien alle Fäden in der Hand hatten und insbesondere über die Postenvergabe allein (und ohne unmittelbare Mitwirkung des Gemeindevolks) entschieden.
Die von den Parteien im Parlament selbstgemachten landesgesetzlichen Schlüsselentscheidungen, die es ihnen erlaubten, möglichst alles unter Kontrolle zu behalten, gingen vor allem in drei Richtungen:
- In Nordrhein-Westfalen besteht ein starres Listenwahlrecht, bei dem parteiinterne Gremien darüber entscheiden, wer über die Liste in den Gemeinderat oder Kreistag kommt. Wen die Partei auf einen „sicheren“ Listenplatz nominiert, der kann schon vor der allgemeinen Volkswahl seines Mandats sicher sein. Ein anderer Teil der Volksvertreter wird zwar direkt in Wahlkreisen gewählt. Doch der Wähler hat nur eine Stimme mit der er gleichzeitig den Direktkandidaten und die Wahlliste der zugehörigen Partei wählen muss, was seinen Freiheitsgrad mindert und die Direktionsmacht der Parteien erhöht.
- Der Chef der Verwaltung, der in Nordrhein-Westfalen Gemeinde-, Stadt- oder Kreisdirektor hieß, wurde nicht direkt durch das Volk, sondern durch den Gemeinderat oder Kreistag gewählt.
- Erster politischer Repräsentant der Gemeinde war der ebenfalls indirekt gewählte Vorsitzende der Volksvertretung.
Das Kontrastmodell ist die „Bürgerverfassung“ in Baden-Württemberg, die ihrerseits zwar durchaus noch verbessert werden könnte, die aber doch vier charakteristische Merkmale einer bürgernahen Verfassung aufweist:
- Es gibt dort bei der Wahl der kommunalen Volksvertretungen keine starren, sondern flexible Wahllisten. Die Bürger haben mehrere Stimmen und können die Reihenfolge der Kandidaten durch Häufeln von Stimmen verändern, Namen streichen und andere hinzufügen.
- Die Bürgermeister werden nicht durch den Gemeinderat gewählt, sondern direkt vom Gemeindevolk.
- Der Bürgermeister ist Chef der Verwaltung und zugleich Vorsitzender des Gemeinderats und seiner Ausschüsse.
- Das Volk besitzt die Möglichkeit, Sachentscheidungen durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheid an sich zu ziehen und anstelle des Gemeinderats selbst zu entscheiden.
Wie die Erfahrungen in Baden-Württemberg zeigen, ergibt sich aus diesen vier Elementen eine hohe Durchlässigkeit des Systems für den Common Sense der Bürger, also mehr Bürgerpartizipation, aber auch mehr politische Handlungsfähigkeit der direkt gewählten Gemeindeorgane. Zugleich werden die Parteien auf ihre eigentliche grundgesetzliche Rolle (Art. 21 GG) zurückgedrängt, nur bei der politischen Willensbildung mitzuwirken (statt sie völlig zu beherrschen). In Baden-Württemberg gehören mehr als 50 Prozent der Bürgermeister keiner Partei an. Und auch die Bürgermeister mit Parteibuch nehmen eine eher distanzierte Stellung gegenüber ihrer Partei ein, um in ihrer Rolle als Repräsentanten aller Bürger ernst genommen zu werden.
Mit der Zurückführung des allseits beklagten übermäßigen Einflusses der Parteien und mit der Wiedereinsetzung der Bürger in ihre demokratischen Rechte geht in der kommunalen Bürgerverfassung aber auch die Diskriminierung der kommunalen Wählergemeinschaften zurück. Ihr Einfluss steigt, weil bei ihnen weniger Parteifunktionäre, sondern die angesehenen Persönlichkeiten zum Zuge kommen, was der Wähler honoriert, wenn ein Persönlichkeitswahlrecht ihm dazu die Möglichkeit gibt. In Baden-Württemberg und Bayern spielen kommunale Wählergemeinschaften seit langem eine gewichtige Rolle, und beispielsweise auch in Rheinland-Pfalz haben die Freien Wähler mit der Einführung der flexiblen Listen bei den Kommunalwahlen, der Direktwahl der Bürgermeister und Landräte und der Zulassung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid einen Aufschwung genommen.
An der Übernahme der süddeutschen kommunalen Bürgerverfassung hatten die politischen Parteien in anderen Ländern allerdings wenig Interesse, weil sie die Dominanz der Parteien, insbesondere bei der Mandats- und Postenvergabe, schwächt. Dennoch hat die baden-württembergische Bürgerverfassung im letzten Jahrzehnt einen beispiellosen Siegeszug erlebt. Die Direktwahl der Bürgermeister ist inzwischen in allen deutschen Flächenstaaten gesetzlich vorgesehen, ebenso die Möglichkeit von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, und auch flexible Listen mit Kumulieren und Panaschieren bei der Wahl des Gemeinderats bestehen in den meisten Ländern.
Die eigentliche, wirklich spannende Frage ist, wie es – trotz des entgegenstehenden Eigeninteresses der politischen Klasse – zu diesen umfassenden Reformen kommen konnte. Ausgangspunkt und eigentlicher Motor der Reformen war ein Referendum in Hessen im Jahre 1991, durch das die Direktwahl der Bürgermeister und Landräte eingeführt wurde. Dadurch wurde zugleich auch der Startschuss für die Reform der Gemeinde- und Kreisverfassungen in anderen Ländern gegeben. Was die politische Klasse so unerhört beeindruckte, war die Höhe des Abstimmungsergebnisses: 82 Prozent der Abstimmenden hatten für die Direktwahl votiert. Dieses Ergebnis war derart überwältigend, dass in Nordrhein-Westfalen dann bereits die glaubhafte Drohung mit einem Volksbegehren durch den Vorsitzenden der dortigen Oppositionspartei, Norbert Blüm (CDU), ausreichte, um den Widerstand der Regierungspartei gegen die Reform der Gemeindeverfassung zu lösen, und ganz ähnlich war es in Niedersachsen (wo der Oppositionsführer Wulff [CDU] die Initiative ergriff, die Ministerpräsident Schröder [SPD] sogleich übernahm und auch in seiner Partei durchsetzte).
Die Entwicklung hin zur Bürgerverfassung hat noch eine weitere Konsequenz: Sie hat die bisher in den meisten Ländern bestehende Sperrklausel bei den Wahlen der kommunalen Volksvertretung fragwürdig gemacht (womit die eingangs behandelte Frage des Wahlrechts noch einmal aufgegriffen werden soll). Eine Fünf-Prozent-Klausel auf Kommunalebene ist unhaltbar geworden, nachdem in allen Flächenländern die Bürgermeister und in den meisten Ländern auch die Landräte direkt gewählt werden. Das wird daran besonders deutlich, dass es in baden-württembergischen Gemeinden, wo die Bürgermeister seit langem direkt gewählt werden, niemals Sperrklauseln gab. Die Sperrklauseln sind denn auch in fast allen Ländern beseitigt worden.
Trotz dieser in den 90er Jahren erfolgten positiven Entwicklung bleibt es in anderen Bereichen bei krassen Benachteiligungen der Freien Wählergemeinschaften. Dies ist z.B. der Fall bei der staatlichen Parteienfinanzierung. Die einschlägigen Gesetze wurden mit Wirkung ab 1994 – auf der Grundlage eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 1992 – völlig umgestaltet und im Jahre 2002 erneut geändert. Um die Benachteiligung der Freien Wähler aufzuzeigen, muß zunächst einmal der Inhalt der bestehenden Gesetze, wenn auch ganz grob, skizziert werden. Man sollte hier unterscheiden zwischen der mittelbaren Staatsfinanzierung der Parteien durch steuerliche Begünstigung von Spenden und Beiträgen und der direkten Subventionierung der Parteien aus der Staatskasse.
Was die steuerliche Begünstigung anlangt, gilt heute folgendes: Spenden und Beiträge an Parteien sind bis zur Höhe von 3300 Euro jährlich (bei zusammenveranlagten Ehepaaren bis zu 6600 Euro) steuerlich begünstigt (§§ 10b, 34g Einkommensteuergesetz). Derartige Regelungen waren früher auf Parteien beschränkt. Durch zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts wurde der Gesetzgeber in den achtziger Jahren gezwungen, auch die kommunalen Wählergemeinschaften in die steuerliche Begünstigung einzubeziehen. Seitdem sind Spenden und Beiträge an kommunale Wählergemeinschaften bis zur Höhe von 1650 Euro (bei zusammenveranlagten Ehegatten bis zu 3300 Euro) jährlich steuerlich begünstigt: Die Hälfte der Zuwendung wird dem Steuerpflichtigen von seiner Steuerschuld abgezogen (§ 34g Einkommensteuergesetz).
Die direkte Subventionierung der Parteien wurde in Deutschland im Jahre 1959 eingeführt. Das war eine europäische Premiere und wäre sogar eine Weltpremiere gewesen hätten nicht Argentinien und Puerto Rico schon vorher eine Staatsfinanzierung gehabt. Die Väter des deutschen Grundgesetzes und die wenigen Mütter hatten sich derartiges nicht einmal im Traum vorstellen können. Und es gibt ja auch heute noch Länder ohne staatliche Parteienfinanzierung wie Großbritannien und die Schweiz. Nachdem die Staatsfinanzierung in der Bundesrepublik erst einmal eingeführt war, kannten die Bundestagsparteien kein Halten mehr: In kürzester Zeit vervielfachte sich der Umfang der Subvention. Da hat das Bundesverfassungsgericht endlich die Notbremse bezogen und der staatlichen Parteienfinanzierung Grenzen gesetzt. Die Gelder wurden durch eine sogenannte absolute Obergrenze nach oben gedeckelt. Diese Obergrenze, die die Parteien auch voll ausschöpfen, beträgt derzeit 133 Millionen Euro jährlich.
Doch die politischen Parteien, die dem Gesetzgeber in Sachen Parteienfinanzierung regelmäßig die Feder führen, umgingen die Obergrenze, indem sie die staatlichen Geldquellen nun auf ihre Hilfsorganisationen umleiteten: Die Parteistiftungen und die Fraktionen im Bundestag und in den Landesparlamenten wurden mit Staatsgeld nur so zugeschüttet und hier hat das Gericht eine Deckelung versäumt. Sie erhalten inzwischen sehr viel mehr Geld aus der Staatskasse als die eigentlichen Parteien. Das kommt auch in den gewaltigen Steigerungsraten zum Ausdruck: Die staatlichen Subventionen an die Fraktionen und die Parteistiftungen haben sich in den vergangenen 30 Jahren mehr als ver40facht.
Der immer wieder diskutierte Abbau von Subventionen ist auch deshalb so schwer, weil die Parteien sich damit ins eigene Fleisch schneiden würden.
Und was die Öffentlichkeit noch gar nicht gemerkt hat: Seit kurzem werden die Parteien zusätzlich noch aus dem Haushalt der Europäischen Union subventioniert. Es fängt zwar klein an. Schon jetzt sind aber jährlich 100 Millionen EUR im Gespräch. Und das ist keineswegs das Ende der Fahnenstange. Das Geld teilen die etablierten Parteien unter sich auf. Die nationale Parteienfinanzierung wird keineswegs entsprechend gekürzt, sondern das EU-Geld kommt noch oben drauf.
Die staatliche Parteienfinanzierung war bei ihrer Einführung Ende der fünfziger Jahre offiziell mit dem Argument begründet worden, dann werde es möglich, Großspenden, die stets im Dunstkreis der Korruption stehen, zu verbieten. Doch dieses Argument wurde später vergessen. Tatsächlich bestehen in der Bundesrepublik jetzt beide übel nebeneinander: Großspenden und üppige Staatsfinanzierung.
Die erwähnten 133 Millionen EUR, die die Parteien aus der Staatskasse erhalten, sind ein Zuschuss zur Finanzierung ihrer Kosten. Es gibt also keine staatliche Wahlkampfkostenerstattung mehr wie früher, sondern einen Zuschuss zum gesamten Finanzaufwand der Parteien und zwar für alle Ebenen, auch die kommunale Ebene. Seitdem dürfte eigentlich klar sein, dass die Nichtbeteiligung der kommunalen Wählergemeinschaften mit dem hier anzuwendenden strengen verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Dahin zielte auch eine Bemerkung in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1992. Auch die vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker eingesetzte siebenköpfige Parteienfinanzierungskommission (zu deren Mitgliedern auch ich gehörte) deutete das Urteil so.
Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht es in einem Beschluss von 1998 abgelehnt, die Verfassungswidrigkeit der Regelung festzustellen. Die klagende kommunale Wählergemeinschaft von Weinheim an der Bergstraße habe nicht darlegen können, dass die kommunalen Parteigliederungen etwas von der staatlichen Parteienfinanzierung hätten und dadurch die Wettbewerbslage der kommunalen Wählergemeinschaft Weinheim in einer ins Gewicht fallenden Weise verschlechtert worden sei. Mit dem sechs Jahre zurückliegenden Urteil unseres höchsten Gerichts war dieser Beschluss nicht mehr vereinbar.
Und freiwillig sind die Landesgesetzgeber offenbar nicht bereit, die Freien Wähler an den staatlichen Pfründen zu beteiligen. Höchstens scheinen sie versucht, das Winken mit einem solchen Gesetz als Druckmittel einzusetzen, um die Freien Wähler von einer Beteiligung an den Landtagswahlen abzuhalten.
Andererseits: Will man dem Beschluss des Gerichts auch etwas Gutes abgewinnen – sozusagen im Sinne einer übergreifenden List der Vernunft -, mag man sich mit folgender Überlegung trösten: Staatsmittel hätten den Charakter der bisher allein auf das Engagement ihrer Mitglieder gegründeten Wählergemeinschaften wahrscheinlich verändert – und möglicherweise nicht zum Besseren.
In einem anderen – gleichzeitig ergangenen – Beschluss hat derselbe Senat die Körperschaftsteuerpflichtigkeit (und die frühere Vermögensteuerpflichtigkeit) von kommunalen Wählervereinigungen und deren Dachverbänden, von denen die Parteien und ihre Gebietsverbände befreit sind, für verfassungswidrig und insoweit nichtig erklärt.
Die Diskriminierung der kommunalen Wählergemeinschaften bei der Parteienfinanzierung wird durch viele immer weiter ausgebaute Formen der heimlichen Staatsfinanzierung der Parteien verstärkt. Die gewaltig angeschwollene Finanzierung der Parlamentsfraktionen des Bundes und der Länder habe ich schon erwähnt. Nach dem Fraktionsgesetz des Bundes dürfen die Mittel der Bundestagsfraktionen sogar für Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Abgeordneten vor Ort verwendet werden, was, natürlich erst recht positive Rückwirkungen auf die kommunalen Erfolgsaussichten der zugehörigen Parteien haben kann.
Große Vorteile erwachsen den Parlamentsparteien auch daraus, dass ihre Landtagsabgeordneten ihren finanziellen Status im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut haben. Während die Mandate ursprünglich als Ehrenämter ausgestaltet waren und die Bezüge von Landesparlamentariern noch in den sechziger Jahren nur einen Bruchteil der Bezüge von Bundestagsabgeordneten ausmachten, haben viele Landtage ihre Bezüge inzwischen gewaltig erhöht. Selbst in einem sehr kleinen und armen Bundesland wie dem Saarland wurden die Landtagsmandate zu voll alimentierten und überversorgten Full-time-jobs aufgebläht – und das, obwohl die Aufgaben der Landesparlamente im Laufe der Zeit drastisch zurückgegangen sind und durchaus auch in zeitlich begrenzten Sitzungsperioden erledigt werden könnten. Daran ändert auch die kürzlich beschlossene kleine Föderalismusreform nichts Wesentliches.
Die Überfinanzierung der deutschen Landesparlamentarier gibt den Parteien die Möglichkeit, ihre Abgeordneten als „vom Landtag bezahlte Parteiarbeiter von Montag bis Freitag einspannen zu können“ (so der ehemalige Bundestagspräsident von Hassel), und bringt die Abgeordnetenbezahlung in den Bereich der indirekten Parteienfinanzierung. Die Mandatsinhaber werden durch die Überbezahlung in den Stand gesetzt, tagein, tagaus vor Ort aktiv und ihrer kommunalen Parteigliederung auf Staatskosten auf vielfache Weise dienstbar zu sein und Kommunalmandate bis hin zum Fraktionsvorsitz in einer Weise auszuüben, wie dies ein Berufstätiger sich meist gar nicht leisten kann. Wenn die Kommunalorganisationen der politischen Parteien aber über Landtagsabgeordnete verfügen, die, soweit sie in der Landeshauptstadt abkömmlich sind, vor Ort als staatsbezahlte Parteiarbeiter zur Verfügung stehen können, bedeutet das einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den kommunalen Wählergemeinschaften, die über solche Formen verdeckter staatlicher Parteienfinanzierung – mangels Landtagsabgeordneter – natürlich nicht verfügen.
Ein anderes Beispiel: Bundestagsabgeordnete haben ihre Amtsausstattung mit Mitarbeitern sprunghaft ausgeweitet. Bundestagsabgeordnete erhalten nicht nur eine steuerpflichtige Bezahlung von 7009 Euro monatlich, eine üppige Altersversorgung ohne eigene Beiträge und eine dynamisierte steuerfreie Kostenpauschale von 3647 Euro im Monat, sondern – und das ist in der Öffentlichkeit bisher kaum bekannt – zusätzlich noch bis 13660 Euro monatlich für die Bezahlung von Mitarbeitern. Das erlaubt es ihnen, im Durchschnitt sechs Mitarbeiter zu beschäftigen, diese auch vor Ort – mehr oder weniger verbrämt – als staatsfinanzierte Parteiarbeiter einzusetzen. Das verschafft den Parteien als weitere Erscheinungsform der heimlichen Parteienfinanzierung ebenfalls beträchtliche Wettbewerbsvorteile gegenüber den kommunalen Wählergemeinschaften.
Die Staatsfinanzierung der Parteien, der Fraktionen, der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter, der Minister und Parlamentarischen Staatssekretäre, die die politische Klasse in eigener Sache geradezu epidemisch ausgeweitet hat, begründet insgesamt eine Verkrustung des politischen Systems im Allgemeinen und eine Benachteiligung der kommunalen Wählergemeinschaften im Besonderen.
Ein weiteres Feld der Diskriminierung ist der Missstand der parteipolitischen Ämterpatronage, im Volksmund auch Parteibuchwirtschaft genannt. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat ganz offen davon gesprochen, die Parteien würden sich den Staat allmählich zur Beute machen. Das zeigt sich bei der Besetzung wichtiger Posten. Die Parteien stellen ja nicht nur das Parlament und die Regierung im Bund und in den Ländern (was in der parlamentarischen Demokratie völlig in Ordnung ist), sondern nehmen auch da Einfluß, wo sie eigentlich nichts zu suchen hätten.
Der Einfluss der Parteien auf die Personalauswahl im öffentlichen Dienst ist weit verbreitet. Dabei umfasst parteipolitische Ämterpatronage nicht nur politische Beamtenstellen, sondern in zunehmendem Maße auch das normale Berufsbeamtentum und auch öffentliche Angestelltenpositionen.
Die rechtliche Beurteilung solcher Ämterpatronage fällt eindeutig aus: Sie ist gesetzes- und verfassungswidrig. Nach den Beamtengesetzen und dem Grundgesetz dürften Parteien grundsätzlich keinen Einfluss auf die Besetzung jener Stellen nehmen. Ämterpatronage ist eine – meist verdeckte – Form der Diskriminierung für die Hintangestellten und der Privilegierung für die aufgrund ihrer Parteimitgliedschaft Bevorzugten und deshalb mit elementaren Prinzipien des Grundgesetzes unvereinbar (Art. 3 II, 33 II, III und V GG).
Die Folgen solch massenhaft rechtswidriger Praxis sind gewichtig: Wer nicht das richtige Parteibuch besitzt, kann vom Zugang zum und vom Weiterkommen im öffentlichen Dienst praktisch ausgeschlossen sein. Das gilt natürlich auch für Personen, die überhaupt kein Parteibuch besitzen. Freie Wähler werden auch aus diesem Grund diskriminiert. Die parteipolitische Abstinenz aufgrund der Mitarbeit in Freien Wählergemeinschaften kann also Karrierenachteile mit sich bringen und auch negative Rückwirkungen auf die Attraktivität von Wählergemeinschaften haben.
Die Parteien durchsetzen aber nicht nur den öffentlichen Dienst, sondern auch alle möglichen Kontrollinstanzen mit ihren Parteigängern und suchen diese dadurch bis zu einem gewissen Grad gleichzuschalten. Da alle etablierten Parteien derartige Ämterpatronage betreiben und dies auf Bundes-, Landes-, Kommunal- und Europaebene, nur eben jeweils mit unterschiedlichen politischen Vorzeichen -, pflegt keine die anderen wegen dieses Beutesystems öffentlich zu kritisieren. Es besteht ein Kartell des Verschweigens, eine Omerta der politischen Klasse.
Betroffen sind:
hohe Gerichte, insbesondere Verfassungsgerichte,
die Spitzen der Rechnungshöfe,
wichtige Positionen in den öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehanstalten,
Führungspositionen in öffentlichen Unternehmen,
Spitzenpositionen in Schulen und allmählich auch in den Universitäten,
Sachverständigenkommission und sonstige Einrichtungen der wissenschaftlichen Politikberatung.
Der zunehmende Einfluß der Parteipolitik auf diesen Institutionen erscheint deshalb besonders prekär, weil damit auch diejenigen Bereiche kolonisiert werden, die jene Politik eigentlich kontrollieren sollten. So hat zum Beispiel das BVerfG bisher nichts gegen parteipolitische Ämterpatronage unternommen trotz deren offensichtlicher Verfassungswidrigkeit. Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, daß der Grund für diese bemerkenswerte Abstinenz des Gerichts auch darin zu suchen ist, daß die Mitglieder des Gerichts selbst in Glashaus besitzen, da sie ebenfalls von den Parteien bestimmt werden. Ich komme darauf noch zurück.
Nehmen wir als weiteres Beispiel die Spitzen der 17 Rechnungshöfe des Bundes und der Länder: Der Präsident gehört regelmäßig der einen und der Vizepräsident der anderen großen Partei an, und sie werden es sich dreimal überlegen, ob sie mit ihrer Kritik ihren Parteigenossen wirklich wehtun wollen. Würden die Spitzen der Rechnungshöfe dagegen nicht von denen ausgewählt, die sie kontrollieren sollen, sondern würden sie unmittelbar vom Volk gewählt, würden die Kontrolleure mit Sicherheit ganz anderen Druck auf die politische Klasse entfalten. Dann würden sie die Interessen der Bürger sehr viel massiver wahrnehmen und sehr viel nachdrücklicher Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung und der gesamten Politik einfordern, wie das eigentlich ja auch ihre Aufgabe ist.
Ein anderes Feld für Parteipatronage ist sehr öffentlich-rechtliche Rundfunk. Fritz Schenk, der legendäre Moderator des ZDF-Magazins, stöhnte schon vor Jahren, es sei nicht zutreffend, daß öffentlich-rechtliche Anstalten von den Parteien dominiert würden, sie gehörten ihnen. Parteitickets entscheiden über Karrieren.
Besonders ausgeprägt ist die Patronage auch bei öffentlichen Wirtschaftsunternehmen. Fast kein Elektrizitätswerk, keine öffentliche Sparkasse, kein städtischer Verkehrsbetrieb, kein irgendwie zum öffentlichen Dienstleistungssektor gehöriger Betrieb wird nicht auch als Versorgungsunternehmen für Parteigänger und Parteimitglieder missbraucht.
Ein fatales Beispiel bietet das Land Berlin. Dort hat die Unfähigkeit politisch infiltrierter Unternehmensführungen zig Milliarden Verluste verursacht und das Land finanziell ruiniert. Daß die öffentliche Hand überhaupt Unternehmen hält, wird regelmäßig mit hehren Zielen gerechtfertigt, die in der Praxis aber kaum je erfüllt, oft nicht einmal formuliert werden. Um so nachhaltiger ist der Run sogenannter verdienter Parteipolitiker auf die höchst lukrativen Posten.
Auch Schlüsselstellungen der Bildung sind gezielt Gegenstand parteipolitischer Ämterpatronage wie etwa die Ämterverteilung in den Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung. Auch in den Schulen reden die Parteien ein gewichtiges Wort mit. Ohne Parteibuch Leiter (in) einer größeren Schule zu werden, ist nur noch schwer möglich. Mitglieder von freien Wählergemeinschaften werden nicht berücksichtigt oder sind stark unterrepräsentiert. Der Gedanke, daß die Parteipolitisierung der Spitzen unserer Schulen etwas mit deren schwachen Leistungen zu tun haben könnte, ist bisher offenbar noch niemandem gekommen.
Generell gilt: Wenn das Parteibuch im gesamten öffentlichen Bereich immer wichtiger wird, sind immer mehr öffentliche Bedienstete versucht, aus opportunistischen Karriere-Gründen in eine Partei einzutreten. Die Praxis der Parteibuchwirtschaft lockt also karrierebewusste öffentliche Bedienstete in die Parteien. Aus der Sicht der Parteien dienen Einstellungen und Beförderungen im öffentlichen Dienst nach Parteibuch häufig auch als Belohnung für frühere Parteiaktivitäten oder werden in der Erwartung vorgenommen, daß die Patronierten in Zukunft umso intensiver für die Partei zur Verfügung stehen. Ämterpatronage läuft insoweit auch auf eine wiederum die etablierten Parteien bevorzugende indirekte Form der staatlichen Parteienunterstützung hinaus (die hier allerdings nicht durch Instrumentalisierung von Gesetzen für Parteizwecke erfolgt, sondern im Wege einer gesetzeswidrigen Praxis).
Mit dem zunehmenden Eintritt von Beamten in die Parteien kommt es auch zu einer immer stärkeren Verbeamtung der Parlamente. In den Parteien haben nämlich Beamte besonders gute Chancen, vorwärts zu kommen und für Parlamentsmandate nominiert zu werden. Das liegt nicht zuletzt an ihrem Zeitreichtum. Um in den beiden großen Parteien etwas zu werden, muss man nämlich eine langjährige parteiinterne Ochsentour auf sich nehmen. Das verlangt vor allem eines: die Möglichkeit, über die eigene Zeit zu disponieren. Und das können viele Beamte, vor allem Lehrer, die in Deutschland üblicherweise nur am Vormittag Unterricht zu geben haben. Die Folge ist eine Verbeamtung der Parteien und eine noch stärkere Verbeamtung der Parlamente.
Die Verbeamtung der Parlamente ist ein typisch deutsches Problem. Fast die Hälfte der 2.800 deutschen Parlamentarier des Bundestags, der sechzehn Landesparlamente und des Europäischen Parlaments kommt aus dem öffentlichen Dienst, darunter eben viele in Deutschland ja beamtete Lehrer. Von daher auch der sarkastische Schnack: Die Parlamente sind mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer.
Ursprünglich sollte das Grundgesetz ein Verbot enthalten, wonach Beamte und Richter nicht in die Parlamente gewählt werden dürften. So ist es auch in Großbritannien und in den USA. Doch eine solche Vorschrift war im Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz 1949 entwarf, nicht durchzusetzen; die Mitglieder des Parlamentarischen Rats kamen ja selbst zu 60 Prozent aus dem öffentlichen Dienst.
Wie aber sollen völlig verbeamtete Parlamente noch die nötige Distanz aufbringen, die Verwaltung und den öffentlichen Dienst grundlegend zu reformieren? Wie sollen Lehrer-Parlamente die Schulen, also quasi sich selbst, reformieren, so notwendig solche Reformen in Deutschland auch wären, wie nach den Pisa-Studien auch dem Letzten klar geworden ist.
Besonders folgenreich kann parteipolitische Ämterpatronage für kommunale Wählergemeinschaften bei der Besetzung der Verfassungsgerichte sein. Nehmen wir als Beispiel wiederum das BVerfG. Dort hat sich folgende Praxis eingespielt: Die eine Hälfte der 16 Richter des Gerichts wird von der CDU/CSU bestimmt, die andere Hälfte von der SPD, wobei in der Zeit kleiner Koalitionen die jeweilige Regierungspartei ihrem kleineren Koalitionspartner einen Posten zur Besetzung überlässt. Kandidaten mit Parteibuch werden dabei massiv bevorzugt. Dieses Verfahren benachteiligt ebenfalls Freie Wähler. Es ist zudem verfassungswidrig, wie Staatsrechtslehrer mutig denn diese Feststellung geht an die Wurzel herausgearbeitet haben. Die Zusammensetzung der Parlamente nur aus Parteien führt also auch zu Einseitigkeiten bei der Besetzung der Gerichte, die in der Tat fast ausschließlich aus Mitgliedern der Parlamentsparteien zusammengesetzt werden. Hier bestimmen die Parteien in den Parlamenten nicht nur die Spielregeln des Wettbewerbs mit den kommunalen Wählergemeinschaften (siehe oben), sondern wählen auch die Schiedsrichter aus, die über die Verfassungsmäßigkeit der Wettbewerbsregeln wachen sollen. Inwieweit man von diesen dann noch unvoreingenommene und faire Entscheidungen erwarten kann, wenn es um Auseinandersetzungen zwischen den Parlamentsparteien, denen die Richter ihr Amt verdanken, und den kommunalen Wählergemeinschaften geht, erscheint mir eine Schlüsselfrage für die Legitimation unserer Demokratie zu sein.
Zusammenfassend ergibt sich: Der Appell an Fairness und Gerechtigkeit allein verhallt unter Profis leicht ungehört. Das gilt im Sport wie auch in der Politik. Im Kollisionsfall geben die meisten Politiker ihren Macht- und Berufsinteressen Vorrang vor Gerechtigkeit und Gemeinwohl. Hauptberuflichen Politikern ist das eigene Hemd regelmäßig näher als der gemeinwohlorientierte Rock. Sie sind – mit den Worten von Weizsäckers – „machtversessen“, wenn es um die Sicherung von eigener Macht, von Posten und Geld geht. Das ist zwar durchaus menschlich und wäre auch gar nicht so schlimm, gäbe es jemanden, der die Parlamentspolitiker wirksam unter Kontrolle hielte. Doch genau daran fehlt es, weil, wenn es um die Eigeninteressen der politischen Klasse geht, auch die parlamentarische Opposition mit im Boot sitzt: Regierung und Opposition einigen sich dann leicht auf Kosten Dritter wie der kommunalen Wählergemeinschaften (und anderer Außenseiter und neuer Wettbewerber), und auch die Medien sind dann nur noch die Hälfte wert, wenn die parlamentarische Opposition sie nicht mehr munitioniert, sondern im Gegenteil an der Verschleierung der selbstbewilligten Privilegien der politischen Klasse kräftig mitwebt – und beide zusammen überdies die Schlüsselpositionen in den öffentlich-rechtlichen Medien selbst nach ihren Vorstellungen und Interessen besetzen. Das Eigeninteresse der politischen Klasse, legt sich wie Mehltau über ganz Deutschland und ist ein wesentlicher Grund für die Erstarrungen der Politik und die zunehmende Politiker-Verdrossenheit der Bürger, die sich auch in einem anhaltenden Rückgang der Wählerbeteiligung, in einem Schwund der Parteienmitglieder besonders der jungen und in Umfragen niederschlägt, nach denen die Mehrheit der Befragten mit dem Funktionieren unserer Demokratie unzufrieden ist.
Die Darstellung dürfte hinlänglich glaubhaft gemacht haben, dass die kommunalen Wählergemeinschaften im politischen Wettbewerb tatsächlich diskriminiert werden.
Inwieweit kommunale Wählergemeinschaften auch bei den Landtagswahlen antreten sollten – nicht zuletzt mit dem Ziel, ihre Benachteiligung bei der Landesgesetzgebung durch Einzug ins Landesparlament an der Wurzel zu packen -, ist innerhalb der Freien Wähler seit eh und je umstritten. Die Gegner befürchten, die Wählergemeinschaften drohten dann ihren Charakter zu verlieren und sich über kurz oder lang von den etablierten Parteien kaum noch zu unterscheiden. Ihre Abgeordneten würden als vollbezahlte und überversorgte Berufsparlamentarier selbst zu Teilen der politischen Klasse werden, gegen deren Selbstbedienung sich die Freien Wähler bisher stets gewandt haben. Viele fürchten auch, die Stimmanteile, die die Freien auf Kommunalebene erlangen, ließen sich auch nicht annähernd in entsprechende Unterstützung bei Landtagswahlen umsetzen. Die wiederholten, aber erfolglosen Versuche in Bayern und Rheinland-Pfalz scheinen die Skeptiker zunächst einmal bestätigt zu haben.
Wenn die Freien Wählergemeinschaften überlegen, was sie sonst unternehmen könnten, so gibt es m.E. vor allem ein wirksames Mittel: die Gesetzgebung selbst in die Hand nehmen, sei es auf kommunaler Ebene im Wege von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, sei es aber auch auf Landesebene im Wege von Volksbegehren und Volksentscheid. Das Beispiel der Gemeindeverfassungen zeigt, dass man auf diesem Wege auch scheinbar blockierte Reformen wieder flottbekommen kann.
Auf diese Weise könnte man z.B. auch die Direktwahl der Ministerpräsidenten durchsetzen. Das würde die Gewaltenteilung zwischen Landesregierung und Landesparlament wiederherstellen und hätte auch sonst viele Vorteile.
Von allein kommen solche Reformen gegen den geballten Widerstand der politischen Klasse allerdings nicht zustande. Es gilt deshalb, aus der Bürgerperspektive eine Strategie zur Durchsetzung der Reform zu entwickeln. Wie wir uns auch drehen und wenden: Wir kommen an der Erkenntnis nicht vorbei, dass dies „unsere Aufgabe ist und wir nicht darauf warten dürfen, dass auf wunderbare Weise von selbst eine neue Welt geschaffen werde“ (Karl Raimund Popper). Politik ist nun mal zu wichtig, als dass man sie allein den Berufspolitikern überlassen könnte.
Ansprechpartner: Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Email: vonarnim@dhv-speyer.de
Homepage: www.arnimvon.de